Gemeinsam den Wandel gestalten
Mit der im Jahr 2015 verabschiedeten Agenda 2030 hat sich die Weltgemeinschaft unter dem Dach der Vereinten Nationen zu 17 globalen Zielen für eine bessere Zukunft verpflichtet. Leitbild der Agenda 2030 ist es, weltweit ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und gleichzeitig die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft zu bewahren. Dies umfasst ökonomische, ökologische und soziale Aspekte. Dabei unterstreicht die Agenda 2030 die gemeinsame Verantwortung aller Akteure: Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft – und jedes einzelnen Menschen.
1 Min. Lesedauer

Deutschland übernimmt Verantwortung und trägt gemeinsam mit seinen Partnern zum erforderlichen Wandel bei.
Foto: Vereinte Nationen
Den Wandel gemeinsam gestalten – was tut die Bundesregierung?

Nachhaltigkeitsziel 1 - Keine Armut
Foto: Bundesregierung

Nachhaltigkeitsziel 2 - Kein Hunger
Foto: Bundesregierung

Nachhaltigkeitsziel 3 - Gesundheit und Wohlergehen
Foto: Bundesregierung

Nachhaltigkeitsziel 4 - Hochwertige Bildung
Foto: Bundesregierung

Nachhaltigkeitsziel 5 - Geschlechtergleichheit
Foto: Bundesregierung

Nachhaltigkeitsziel 6 - Sauberes Wasser und Sanitäte Einrichtungen
Foto: Bundesregierung

Nachhaltigkeitsziel 7 - Bezahlbare und saubere Energie
Foto: Bundesregierung

Nachhaltigkeitsziel 8 - Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
Foto: Bundesregierung

Nachhaltigkeitsziel 9 - Industrie, Innovation und Infrastruktur
Foto: Bundesregierung

Nachhaltigkeitsziel 10 - Weniger Ungleichheiten
Foto: Bundesregierung

Nachhaltigkeitsziel 11 - Nachhaltige Städte und Gemeinden
Foto: Bundesregierung

Nachhaltigkeitsziel 12 - Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion
Foto: Bundesregierung
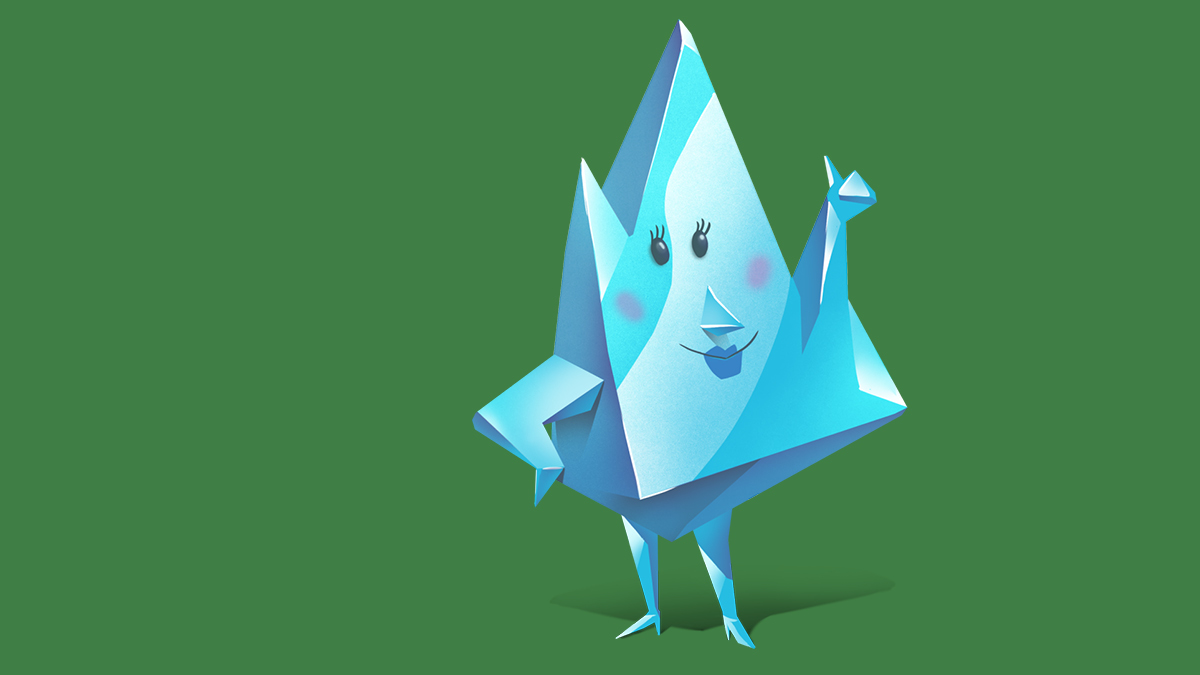
Nachhaltigkeitsziel 13 - Maßnahmen zum Klimaschutz
Foto: Bundesregierung
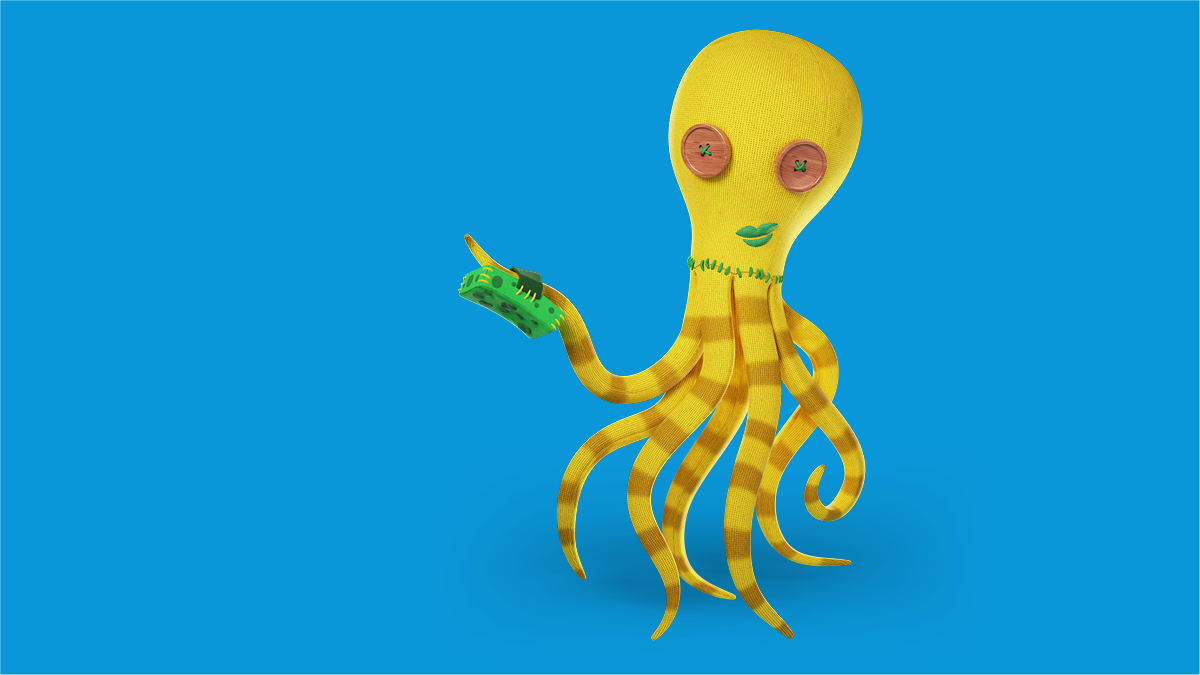
Nachhaltigkeitsziel 14 - Leben unter Wasser
Foto: Bundesregierung

Nachhaltigkeitsziel 15 - Leben an Land
Foto: Bundesregierung

Nachhaltigkeitsziel 16 - Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
Foto: Bundesregierung
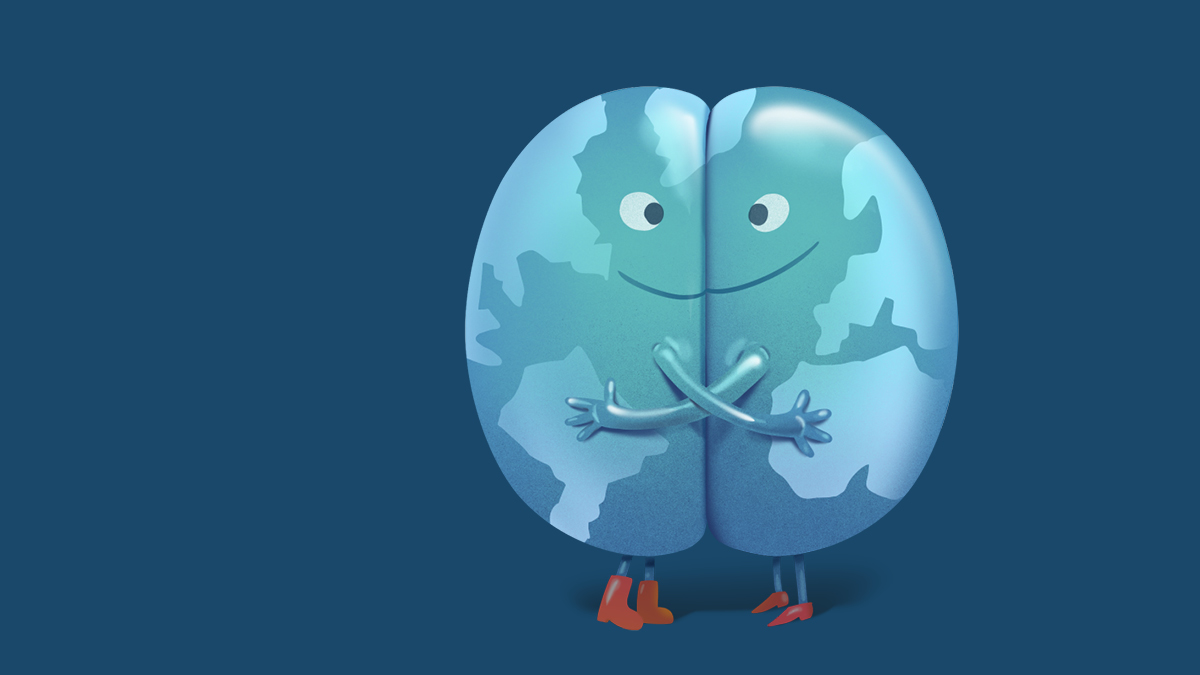
Nachhaltigkeitsziel 17 - Partnerschaften zur Erreichung der Ziele
Foto: Bundesregierung
Ziel 17: Globale Partnerschaft
Mehr Informationen finden Sie auf unserer Themenseite Nachhaltigkeit.